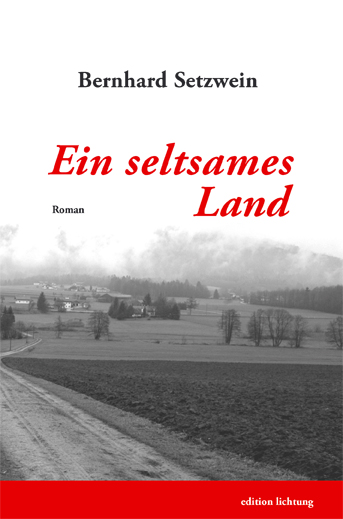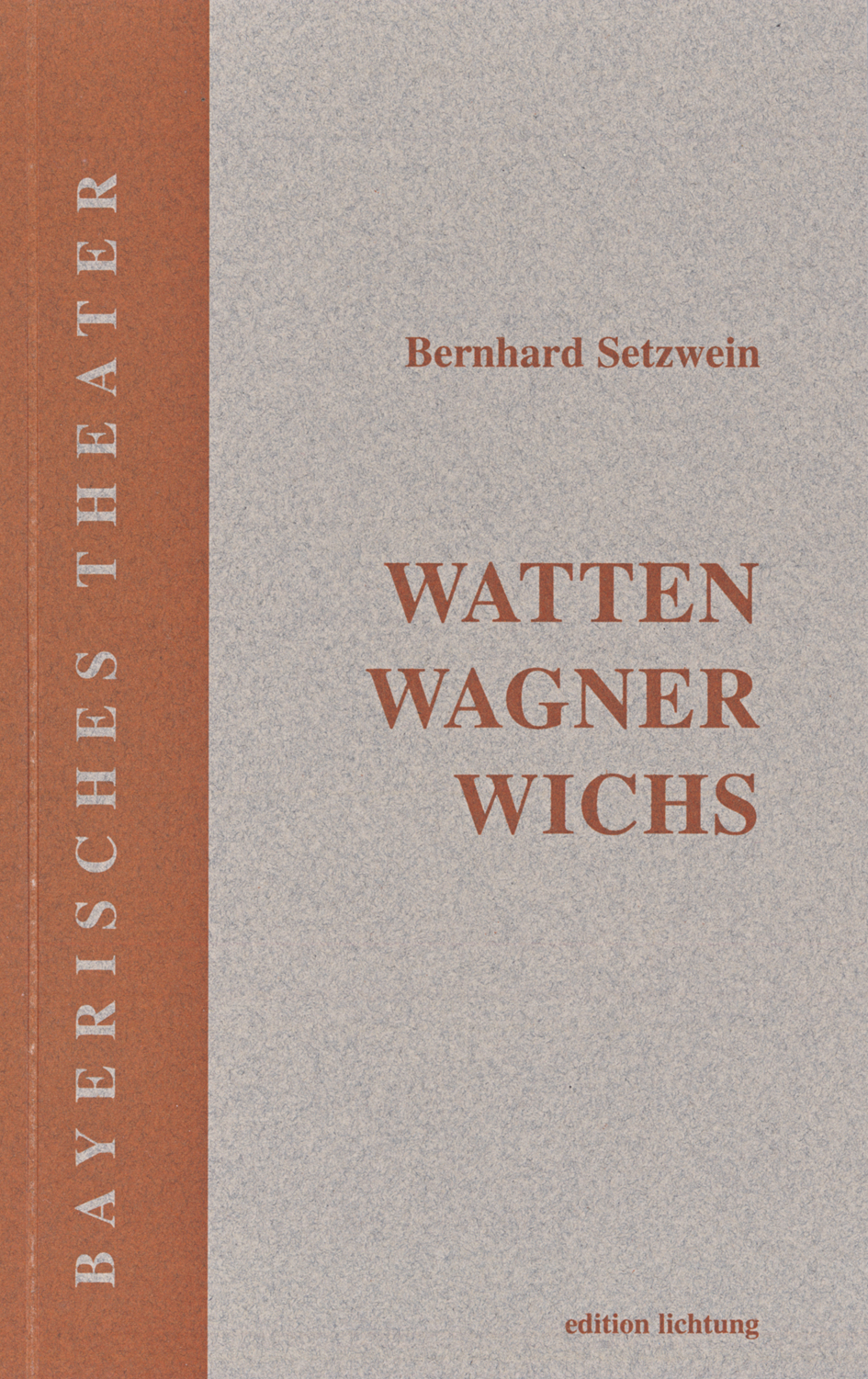Bernhard Setzwein: Ein Fahneneid aufs Niemandsland
12,70 €
Inhalt.
INHALTSVERZEICHNIS
Die Papiere, bitte! Ein Wort vor Reiseantritt
An der Grenze...
zwischen keltischem Größenwahn und slawischer Melancholie oder: Bayern/Österreich - eine unverbrüchliche Feindschaft
Der uralte Streit ums Beuschlprimat. 1000 Jahre Bayern mit und gegen Österreich
„Profund einverblödet in's Gewohnte". Heimito von Doderers Doppelleben zwischen Wien und Landshut
„Wie grausam litt ich in München". Johannes Freumbichlers bayerische Jahre
Gerechtigkeit für Österreich! Ein Interview
... zum böhmischen Meer oder: Auf die Schiffe, Ihr Mitteleuropa-Matrosen!
... und Nemanice heißt Wassersupp'n. Tagebuch einer Grenzöffnung
Der Fürst des Blätterteigs. Ein Besuch im sommerlichen Pilsen
To je fein! Kleines Plädoyer für die Mühe, unsere Nachbarn verstehen zu lernen
„Bleib gesund mir, Krakau!" Eine fast schon verloren geglaubte Stadt kehrt zurück nach Mitteleuropa
Wie ich einmal mit Ladislav Klíma im „U Schneidrù" ein, zwei Stamperl Neunziggrädigen trank
„Meine Helden leben in einem Dschungel." Gespräch mit dem jungen Prager Autor Jáchym Topol
... zur Wörterstadt oder: Sieben Sprünge über ein durchhängendes Seil
Meistens haben wir zum Schluß gelacht. Eine Annäherung an Paul Wühr
... zum bayerischen Schänie oder: Von Volksdichtern, die trotzdem nicht tümlich waren
Das Genie an der Hobelbank. Über Karl Valentin
Sie ist auf den Knien zu ihrem ersten Buch gerutscht. Glück und Unglück der Lena Christ
Hartmut Riederer trinkt mit mir am Starnberger See ein oder vielleicht auch zwei Weißbier. Ein Grantolettl
zu Ehren von Oskar Maria Graf
Das arme Bauerndeandl aus Schiefweg. Die Bayerwalddichterin Emerenz Meier
... zu einem nicht mehr fernen Bayern oder: Verstaubte Zukunftsphotos
Ist Tschüs bairisch? Mundart an der Grenze zum neuen Jahrtausend
Phänomenologie HinterBayerns. Die erkenntnisdienlichen Photografien des Herbert Pöhnl
Horrorsitzweil vorm Zeit-Mausloch. Heimat-Science-fiction und Zukunfts-Spaßettl'n aus Anlaß eines Datumswechsels
Die Papiere, bitte!
Ein Wort vor Reiseantritt
Andere Leut' haben ihre Weltanschauung, ich hab' meine Grenzanschauung. Jeden Tag habe ich die, wenn ich aus dem Fenster meines Arbeitszimmers vom bayerischen Waldmünchen aus auf den Bergrücken des böhmischen Cerchov schaue. Dort oben verläuft eine offene Grenze. Da herunten auf meinem Schreibtisch auch. Über die muß ich tagtäglich hinüber und herüber. Literatur und Grenzübertritt, das sind genaugenommen Synonyme. Für mich jedenfalls. Ein Schreiben, das nicht immer auch einen kleinen Grenzverkehr darstellt, interessiert mich, ehrlich gesagt, wenig. Die Territorien, zwischen denen dabei grenzverkehrt wird, müssen allerdings nicht immer die uns bekannten Ländernamen tragen. Sie können auch heißen: Realienland und Phantasien, Konventionalistan und Verrückisien, Wachmark und Traumauen, Volkrepublik und Ichreich. Das eigentliche Vaterland des Schriftstellers aber ist das Niemandsland zwischen all diesen Territorialmächten. Sein Eid gilt der Niemandslandfahne!
Er ist ein Grenzlandbewohner von Haus aus, von diesem seinem Haus aus, das fast genau auf der Grenze steht. Er streift die Borderline entlang und sieht auch ohne Nachtsichtgerät dunkle Gestalten und dunkle Geschehnisse. Nie ist er ohne Konterbande unterwegs, und kein anherrschender Zuruf ist ihm lieber als der: Die Papiere, bitte! Ja, genau, seine Papiere soll man aufmerksam durchblättern. Man wird sie voller literarischer Sichtvermerke finden.
Von denen soll hier die Rede sein, von meinen ganz persönlichen Sichtvermerken. Ich habe hineingeschaut in Nachbarbücher und Nachbarländer, bin Grenznaturen begegnet, und was ich von ihnen erfuhr, habe ich hier vermerkt. Im übrigen gilt, was Peter Handke in seiner Reise-Erzählung „Die Wiederholung" sagt, die das Karstland zwischen Kärnten und Slowenien beschreibt: „Eine Grenznatur, das ist eine Randexistenz, doch keine Randfigur."
Es sind also meine Reise- und Lese-Eindrücke, die ich mitbringe (man ist ja, liest man, ständig auf Reisen). Ich biete sie lediglich an zum Vergleich mit den Eindrücken anderer. Festpflocken und abgrenzen mit Pfählen möchte ich hier gar nichts. Eher schon einladen, die Wollust des kleinen Grenzverkehrs zu entdecken. Und solche Entdeckungen, wie ich sie meine, sind überall zu machen. Sogar im Landesinnersten.
Das Genie an der Hobelbank. Über Karl Valentin
(Auszug aus dem Text)
Wer sich mit Leben und Werk Karl Valentins beschäftigt, wird über kurz oder lang mit einer Frage konfrontiert werden, die sich in dieser Deutlichkeit nur bei ganz wenigen stellt. Sie lautet: Läßt sich der Fall denken eines Genies, das nicht das geringste Bewußtsein davon hat, eines zu sein? Mir fiele kein zweites Beispiel eines Künstlers ein, der auf der einen Seite ein so innovativer, genuin schöpferischer Geist war, der - es ist mittlerweile hinreichend analysiert worden - sämtlichen Ästhetiken der Moderne vom absurden Theater bis zum Dadaismus unbewußt (?) gefolgt ist bzw. sie mit entwickelt hat (er war unzweifelhaft ein Pionier des damals gerade aufkommenden Mediums Film) und der auf der anderen Seite so offensichtlich überhaupt keinen Begriff davon hatte, was er da eigentlich schuf. Valentin selbst hielt es wahrscheinlich für Vorstadtkomik. Die anderen Fälle, die der anfänglich verkannten Genies, die wenigstens immer einen hatten, der an sie glaubte, nämlich sich selbst, die sind dagegen geradezu Legion. Ob James Joyce, Bert Brecht oder Ludwig Wittgenstein, ja selbst ein stets skrupulöser Franz Kafka, sie waren sich, trotz aller depressiven Phasen und trotz aller temporären Versagensgefühle, doch immer bewußt, Auserwählte zu sein und ließen es ihre Umwelt auch mehr oder weniger deutlich spüren. Daß ich aus der Fülle der Beispiele übrigens ausgerechnet die eben Genannten auswählte, hängt damit zusammen, daß sie alle vier unübersehbar in einer Geistesverwandtschaft mit dem Münchner Komiker stehen.
Und Karl Valentin? Erstens einmal war er völlig desinteressiert, was die künstlerischen Neuerungen seiner Zeit betraf. Gelesen hat er so gut wie nichts, seine Bibliothek bestand aus einer Handvoll Büchern, neben einem Gartenbuch und einem Gedichtband von Kurt Schwitters (!) unter anderem der Sammelband „Perlen pessimistischer Weltanschauung" ... immerhin! Letzteres war wohl so etwas wie das Hausbuch des Hypochonders. Ansonsten war ihm seine Misanthropie als Quelle der Inspiration wichtiger als allzuviel Wissen darüber, was in der neueren Kunst vor sich ging. Valentin wollte Volkssänger und Bühnenkomiker sein, vielleicht etwas besser als all die anderen, als „Papa" Geis oder der Weiß Ferdl zum Beispiel. Sein Anspruch ging aber nicht darüber hinaus, mehr als ein universal einsetzbarer „Schriftsteller für Bühne, Film, Zeitung, Rundfunk usw." zu sein (wie er gelegentlich unter seinen Namen im Briefkopf schrieb), ein redlicher, braver Handwerker nicht nur an seiner Heimwerkerhobelbank, wo er sich seine eigenen Requisiten zusammenzimmerte, sondern auch am Schreibtisch. „Er ist der Volkskomiker, dessen einziges Kalkül handwerkliche Vollkommenheit ist", schreibt Michael Glasmeier in seiner sehr lesenswerten Untersuchung „Karl Valentin, der Komiker und die Künste". Sicher, manchmal polterte Valentin, er könne schon längst ein deutscher Charlie Chaplin sein, wenn man ihn nur ließe, doch wahrscheinlich wollte er damit am allerwenigsten zum Ausdruck bringen, er sei ein Genie wie Chaplin, sondern allenfalls: ,Was der kann, kann ich auch.` Es war Handwerkerstolz, so wie wenn ein Metzger seine Weißwürscht mit denen der Konkurrenz vergleicht.
„... ein durchaus komplizierter, blutiger Witz"
Er lebe von „Unsinnfabrikation" schrieb Valentin in seiner Selbstbiographie, und damit auch ganz klar wurde, daß er sich darauf nichts einbildete, setzte er noch hinzu: „wie die meisten seiner Mitmenschen". Niemals hätte er von sich selbst gesagt, er sei eben ein Genie. Das Komische - im valentinschen Sinne auch als das ,Saudumme` zu verstehen - ist aber, daß er eins war! Und zwar eines, wie sein erster Biograph Michael Schulte meint, das von Anfang an „fertig" war und sich im Grunde überhaupt nicht entwickeln mußte. Nicht wenige haben das schon zu Lebzeiten erkannt. Die teilweise verzückten Lobeshymnen, ob von Kurt Tucholsky, Hermann Hesse, Alfred Polgar, Lion Feuchtwanger, Oskar Maria Graf, Franz Blei, Anton Kuh und noch manch anderem, wie oft sind sie schon zitiert worden? ( Und Brecht natürlich mit seinem so wahren Wort, Valentin mache keine Witze, er sei einer, „ein durchaus komplizierter, blutiger Witz.") Beckett sah sich bei seiner München-Reise einen Valentin-Abend an und gestand später, er habe „viel und traurig gelacht". Brecht, der sechzehn Jahre jüngere, hat eindeutig von ihm gelernt, und das nicht nur bei dem gemeinsamen, auf einem Dachspeicher in der Tengstraße gedrehten Groteskfilm „Mysterien eines Friesiersalons", von dem die Forschung bis heute nicht zu sagen wüßte, ob das auf uns gekommene Filmmaterial ein Fragment oder in sich abgeschlossen sei ... vonwegen „offene Form" des modernen Kunstwerks!
Valentin selbst meinte zu all dem: „Ich weiß garnet, was die Kritiker da alles finden, in meine Sachen - ich will doch bloß, daß die Leut lachen." (An anderer Stelle allerdings sagt er auch, daß es ihm selbst nie zum Lachen gewesen sei.) Dabei hat er die größten interpretatorischen Anstrengungen ja gar nicht mehr kennengelernt. Was würde er erst sagen, sähe er, wie mittlerweile sein Werk Gegenstand philosophisch-philologisch höchst verzinkter Aufsätze geworden ist. In der „Deutschen Zeitschrift für Philosophie" zum Beispiel, wo ihn der Autor Walter Gönner in einen Zusammenhang mit Hegel, Schelling und Kant bringt? Alles Blödsinn? Wirklich? Würde er reagieren, wie all jene wahren und selbsternannten Sachwalter, die es gar nicht gern sehen, wenn ihnen ihr volkstümlicher Valentin in den Pantheon solcher Geistesheroen entführt wird - er gehört ihrer Meinung nach aufs Vorstadtbrett'l und sonst nirgends hin! - und die dann, wie Karl Wanninger (keine von Valentin erfundene Figur!), schon mal schreiben, „unerträgliche Schwätzer zerdeuteln ihn mit intellektuellen Verrenkungen, faseln höchst gestelzt über ihn"?
Valentin Ludwig Fey, so der nach der Entbindung am 4. Juni 1882 eingetragene Geburtsname Valentins, trat mit 14 Jahren eine Lehre bei dem Schreinermeister Hallhuber in Haidhausen an. Der Vater wollte es so. Den gebürtigen Darmstädter hatte es nach München verschlagen, wo er durch Einheirat Mitinhaber des „Möbeltransportgeschäftes Falk & Fey" in der Münchner Vorstadt Au geworden war. Seine erste Frau starb bereits im Alter von nur 28 Jahren, Johann Fey heiratete ein zweites Mal, die aus Zittau in Sachsen stammende Johanna Schatte, Valentins Mutter. Vier Kinder brachte sie zur Welt, geblieben ist ihr nur der jüngste, die zwei älteren Brüder Valentins starben sechs- und achtjährig an Diphterie, die Schwester nur wenige Monate nach der Geburt. (Das sagt schon fast alles aus über die Lebensverhältnisse damals im Münchner Glasscherben-Vorort Au!) Auch er selbst war von dieser extrem ansteckenden Krankheit befallen, ja der Arzt hatte schon jede Hoffnung aufgegeben, wie durch ein Wunder überlebte er. Valentins spätere lebenslange Hypochondrie hatte also durchaus ihre Gründe!
Und nun sollte er also Nachfolger des Vaters in der Spedition werden. Da konnte es sicher nicht schaden, etwas von Möbelschreinerei zu verstehen. Daß Karl Valentin von seinem Vater auf den Lebensweg eines Handwerkers geschickt wurde, wird dieser sicher nicht zum Anlaß einer Rebellion genommen haben, vonwegen er sei doch ein Künstler, im Gegenteil: Valentin betätigte sich gern handwerklich, und genaugenommen, wenn man die Zeit beim Schreinermeister Hallhuber als Bühnenrequisiteurslehre betrachtet, war das genau die richtige Vorbereitung für den späteren Allrounder. Ob Film- oder Bühnenkulissen, ob die „dekonstruktivistischen" Unsinns- und Horrorinstallationen für seine verschiedenen Panoptiken, Valentin wußte sich stets selbst zu helfen, den Großteil seiner Requisiten baute er sich an seiner eigenen Werkbank zusammen. Ja, man könnte sogar soweit gehen, in dieser „geliebten Hobelbank" einen zentralen Entstehungsort seiner Kunst zu sehen ... jedenfalls tat dies auch der jüdische Münchner Photograph Nachum T. Gidal, den Valentin als einzigen der Reportermeute je in seine Wohnung ließ. Er photographierte den Künstler in seiner Bastlerecke und schrieb: „Im langen engen Korridor steht die geliebte Hobelbank, Erfinder- und Experimentierwerkstatt zugleich."
In einem Anfall von Löwenbräubierriesenrausch
Dieses handwerkliche Talent spielte auch eine entscheidende Rolle bei Valentins Bühnenstart. Denn nach ein paar kurzen, nicht immer erfolgreichen Auftritten als Vereinshumorist (drei Monate lang hatte Valentin die Münchner Varietéschule besucht!), verlegte er sich auf ein Gebiet, auf dem er schon eher aus dem Gros der Vorstadthumoristen hervorstach: Er trat als „lebendes Orchestrion" auf! Schon allein dieses Ungetüm, bestehend aus 27 Instrumenten samt Lichtspielen und Kanonenschlag, zusammenzubauen, war eine Leistung. Sie auch noch alle zu spielen, und zwar als „liebliche Musik! Keine Lärmmusik", wie auf Handzetteln angekündigt wurde, eine akrobatische Glanznummer. Also nicht nur Handwerker, sondern auch noch Musiker war Valentin, wobei auch hier auffällt, daß ihm ein laienhaftes Von-allem-ein-bißerl-was-Können wichtiger war als ein virtuos-geniales Solokünstlertum. Musikunterricht hatte er in Zither und Mandoline, außerdem spielte er aber auch noch Trompete, Posaune, Tuba, Waldhorn, Klarinette, Pikkoloflöte, Ziehharmonika, Gitarre und Geige.
Doch mit seiner Nummer vom „lebenden Orchestrion", mit der Valentin schließlich bis nach Berlin vordrang, war es so eine Sache. Er kam nämlich nur deshalb soweit damit herum, weil ihm jedes Mal nach dem ersten Auftritt sein Engagement gekündigt wurde. Die rein mechanische Konkurrenz der damals aufkommenden Musikapparate war stärker. Schließlich, „in einem Anfall von Löwenbräubierriesenrausch", wie er selbst schreibt, „zerstörte ich mit einem Holzhackel meinen ganzen komplizierten Musikapparat". Eine Ur-Szene valentinesker Destruktionskomik: Er befreite sich brachial und rabiat aus jenen Zwängen der Objekte, die er sich zuvor selbst geschaffen hatte. Ob es die zu langen Beine des Stehpults sind, die er in dem bekannten Grotesk-Stummfilm aus dem Jahre 1913 einzeln nach und nach so lange absägt, bis er nur mehr mit abgewinkelten Beinen sitzend darunterpaßt oder der Scheinwerfer, der keine Scheine mehr wirft oder die nicht mehr zu stoppende Sirene beim Rundfunkvortrag der „Glocke" von Schiller („heulend kommt der Sturm geflogen"), fortan sind es immer wieder vorrangig die Tücken der Technik, mit denen sich Valentin herumschlagen muß.
Meist ... nein, eigentlich immer unterliegt er. Man nenne mir eine Valentin-Szene, bei der technische Abläufe ein einziges Mal nur zur Zufriedenheit aller funktionierten! Daß das Raketenschiff nicht wirklich den „Flug zum Mond" schafft in der gleichnamigen Szene ... na gut, das war zu erwarten. Die leidigen Tücken der fernmündlichen Kommunikation - ständig „falsch entbunden, Verzeihung, falsch verbunden" -, auch das kennt man aus eigener Erfahrung. Daß Notenständer grundsätzlich verhext sind und die falsche Höhe haben, man erwartet es nicht anders. Aber daß selbst die Fahrradhupe nicht funktioniert und man bei deren Betätigung folglich gleichzeitig „Obacht" rufen muß, das führt langsam schon zu dem gnadenlosen Zu-Ende-Denken, wie es nur Valentin vorexerzieren konnte. Am Schluß steht dann der Meterstab, geradezu eine Zentralmetapher Valentins, das heißt, er steht eben nicht, weil er ständig zusammenklappt, so daß man folglich mit diesem Inbegriff der naturwissenschaftlich exakten Methode allenfalls „in Keller abimessn" kann, aber niemals „am Speicher nauf"!
Das sind gewissermaßen die Fallstricke der Objektwelt, über die Valentin ständig stolperte. Wo die Fallstricke in der sprachlichen Kommunikation gespannt sind, das zeigte er anfänglich, als er noch alleine auftrat, in einer Reihe von Solovorträgen. „Sehr geehrter Zuschauerraum", beginnt er zum Beispiel sein Referat über „Unsere Haustiere", „es freut mich hundsgmein, nein! ungemein, daß Sie sich heute zu meinem wissenschaftlichen Vortrag über den Nutzen und Schaden der Haustiere hier eingefunden haben." Es ist aber auch „hundsgemein" mit diesen ewigen Tücken der Sprache ... wenn man Valentin eine Weile lang zuhört, zweifelt man ernsthaft daran, daß sie wirklich ein VERSTÄNDIGUNGSmittel sein soll und nicht eine böse Erfindung Gottes, um die Menschen bis an das Ende ihrer Erdentage unaufhörlich zu tratzen! Nie weiß man, welche Sprachebene zu wählen ist - „Sehr geehrter Herr, unser lieber Joseph" beginnen die Eltern im „Theaterbesuch" den Brief an ihren Buben! -, und nie gelingt es einem, sich wirklich exakt, den wahren Tatbestand treffend auszudrücken - „hochachtungsvoll Deine fortgegangenen Eltern nebst Mutter", so beenden sie den Brief.
Über den Autor.

Bernhard Setzwein
Foto: Hannes Reisinger
Andere Bücher.
Kafkas Reise durch die bucklige Welt
Das gelbe Tagwerk
Der neue Ton
Das blaue Tagwerk
Ein seltsames Land
Watten Wagner Wichs
1998, ISBN 978-3-929517-26-2, 10,20 Euro
Zucker. Ein Stück
1997, ISBN 978-3-929517-18-7, 7,60 Euro

lichtung verlag GmbH
Bahnhofsplatz 2a
94234 Viechtach
Tel.: 09942 2711
Fax: 09942 6857
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!